
Geschichte
Rechen- und Stielfabrikation • Karl Schmid e. K. • Schopfloch/Schwäbische Alb


Unter dem lauten Getöse der gut 60 Jahre alten Maschinen fräst, sägt, schmirgelt und poliert er grobe Vierkanthölzer zu glatten Stielen, die angenehm in der
Hand liegen. Bohrt Löcher in das Rechenhaupt, sodass die Späne in alle Richtungen fliegen und es plötzlich angenehm nach warmen Holz riecht. Fixiert dann
die sorgsam gesägten Rechenzähne mit wenigen Hammerschlägen in den dafür vorgesehenen Löchern. Macht den Wackeltest und sagt schließlich zufrieden:
„Da fällt kein Zahn raus, auch nicht in zehn Jahren."
Alle Zähne sind rausgefallen
Dann verrät Karl Schmid, wieso die Zinken seiner Rechen ganz ohne Leim bombenfest sitzen. “Das Holz für die Zähne muss trocken sein, das für das
Rechenhaupt feuchter", sagt er. Wenn das Holz des Rechenhaupts trocknet, sich zusammenzieht und die Löcher enger werden, dann sitzen die Zähne noch
fester. Mit einem verschmitzten Lächeln erzählt er, was einem Händler widerfahren ist, der vorübergehend anstatt Rechen aus seiner Werkstatt Billigware aus
dem Ausland ins Sortiment genommen hat: „Alle Zähne sind rausgefallen und sie mussten sie einzeln reinleimen." Fortan standen wieder Rechen „Made in
Schopfloch" in dem Laden.
Im Jahr 1944 hat Karl Schmid eine Ausbildung als Wagnermeister in der Werkstatt seines Vaters begonnen. Geschafft wurde damals noch mitten im Flecken,
was wegen des Maschinenlärms nicht jedem Nachbarn gefiel. Kurz vor Kriegsende wurde der Lehrbub noch eingezogen, landete in französischer Kriegs-
gefangenschaft und musste nach seiner Entlassung kräftig ran im elterlichen Betrieb, weil der Vater krank aus dem Krieg heimgekehrt war. Gemeinsam mit
einem seiner vier Brüder hat Karl, der älteste Sohn der Familie, Anfang der 1950er-Jahre eine geräumige Halle am Ortsrand von Schopfloch als neuen Firmen-
sitz gebaut. Der Maschinenpark, der in der Werkstatt steht, stammt noch aus dieser Zeit. Er ist komplett mit einer dünnen Schicht aus gelbem Holzstaub über-
pudert und verrichtet Tag um Tag seinen Dienst, genauso wie die wenigen Modelle, die noch von Karl Schmids Großvater stammen. "Wir haben für jeden
Arbeitsschritt eine eigene Maschine", sagt Karl Schmid stolz - das erspart ihm mühsames Umstellen.
Mit dem Bauboom kamen die Schaufelstiele
Der Rechenmacher zeigt auf die betagte 5-PS-Bandsäge, an der ein verstaubter Kehrwisch baumelt, geht vorbei an der Kreissäge, und steuert auf die U9 zu,
eine Schaufelstielfräsmaschine Baujahr 1953. Das grün lackierte Gerät hat Karl Schmid angeschafft, als die Nachfrage nach Rechen und Holzgabeln zurück-
ging. Weil das Baugewerbe boomte, begann er, auch Stiele für Schaufeln herzustellen.
Karl Schmid geht durch die Halle, vorbei an der Wand mit seinem gerahmten goldenen Meisterbrief, den ihm die Handwerkskammer zum 50. Jubiläum seiner
Meisterprüfung überreicht hat. Er schaltet das Gebläse ein, ein jaulendes Geräusch ertönt. Dann setzt Schmid die Fräsmaschine in Gang, greift sich ein knapp
zwei Meter langes Vierkantholz und schiebt es in die Maschine.
Er baut württembergische und badische Rechen
Jeder Handgriff sitzt. Zwischendurch fördert Schmid aus einer der vielen Taschen seiner Arbeitshose einen Schraubenzieher zutage und zieht rasch eine Mutter
nach. Gleich darauf hat die Fräsmaschine mit lautem Getöse das Holzstück komplett geschluckt und spuckt in Nullkommanichts einen runden Stiel aus.
Mit wenigen Schritten ist Karl Schmid an der Rundstabschleifmaschine, jagt das gerundete Stück Holz an einem rotierenden Stück Schleifpapier vorbei. Danach
lässt er den Stab durch seine Hände gleiten und macht den Fühltest, nickt zufrieden. "Wir verwenden Schleifpapier mit Körnung 150 und machen die Stiele
extra fein", erklärt er.
Dass Stiel nicht gleich Stiel und Rechen nicht gleich Rechen ist, verstehen Besucher erst, wenn Karl Schmid die Tür zu seinem Lagerraum aufschiebt und die
unterschiedlichen Modelle vorführt. Da gibt es den klassischen Holzrechen, der im Württembergischen verbreitet ist. Dessen Stiel teilt Karl Schmid mit der Säge
an der einen Seite in zwei Hälften. Die Enden fixiert er in den beiden Löchern, die er zuvor im Abstand von etwa 20 Zentimetern ins Rechenhaupt gebohrt hat.
Fertig! Das badische Modell ist aufwendiger anzufertigen, aber stabiler. Hier spaltet Karl Schmid den unteren Bereich des insgesamt dickeren Stiels in drei Teile
auf und verankert jedes einzelne in einem der drei Löcher des Rechenhaupts. „Im Badischen haben sie die Rechen dazu benutzt, um die Erde zu Spargelreihen
aufzuhäufeln", erklärt Schmid den Grund, wieso dieses badische Modell stabiler sein musste.
Besonders stolz ist der Schopflocher auf den Rechen, den sein verstorbener Bruder und er in den 1960er-Jahren entwickelt haben. „V-Rechen" nennt Karl
Schmid die stabile Kreation mit hölzernem Stiel und Rechenhaupt, in dem aus Stahl gefertigte, v-förmig zurechtgebogene Zähne stecken. Sie sind, anders als
die hölzerne Variante, bruchfest.
Egal, ob V-Rechen, badisches oder württembergisches Modell: Karl Schmid liefert seine gesamte Produktpalette, zu der auch Schaufel-, Spaten- und
Hauenstiele gehören, noch selbst an seine Kundschaft. “Die Kunden erwarten das", sagt er. Er setzt sich ein bis zwei Mal pro Woche hinter das Steuer seines
grauen VW Pritschenwagens und fährt die Ware aus. Seine Touren führen ihn bis ins Badische, wo er zum Beispiel das Zentrallager der Raiffeisenmärkte in
Kehl am Rhein beliefert.
Früher ist Karl Schmid auf einem Motorrad mit Anhänger zu seinen Kunden geknattert. Und vor dem Krieg hatte man ein Handwägele zum Ausliefern, aber da
war die Kundschaft auch im Umkreis von zehn Kilometern ", erzählt der Schopflocher.
Schon der Uropa fertigte Rechen für die Bauern
In seiner Familie hat die Arbeit mit Holz eine lange Geschichte. Auf einem Lieferschein, den Karl Schmid aus einer Ecke seiner mit Sägemehl überpuderten
Werkstatt herauszieht, prangt der Schriftzug "Tradition seit 1870".
Schmids Urgroßvater, ein Wagner, hat damals Hand- und Leiterwagen als Transportmittel hergestellt. Da fahren heute noch welche rum", sagt Karl Schmid
stolz. Außerdem fertigte schon der Uropa Rechen für die Bauern in Schopfloch und der Umgebung. Sein Sohn und wiederum dessen Sohn folgten seinem
Beispiel. Da war es nur logisch, dass auch Karl Schmid bei seinem Vater in die Lehre ging.
Sein Holz kauft er bei Gemeinden, Städten und Forstämtern der Region. Bis vor zwei Jahren hat er es noch selbst im eigenen Sägewerk zurechtgeschnitten, auf
Paletten gesetzt und ein bis zwei Jahre trocknen lassen. Inzwischen aber wird es angeliefert - es gibt auch so genug zu tun für den betagten Rechenmacher
und die zwei 450-Euro-Kräfte, die er beschäftigt.
Gerade einmal ein Stündchen Mittagspause genehmigt sich der fast 87-Jährige während seiner Sechs-Tage-Woche.
Wer rastet, der rostet - davon ist Karl Schmid zutiefst überzeugt. Wenn die Leute nicht mehr gerne schaffen, dann fängt das Ende langsam an. Und wenn man
sich nicht bewegt, geht es gleich ganz schnell den Bach runter", sagt der Mann mit der Schildkappe, und fügt - wie als Beweis - hinzu: „Ich war noch nie krank".
Ein Grund dafür mag sein, dass er seine Arbeit mit Freude verrichtet Und während sich andere spätestens mit 65 in den Ruhestand verabschieden, denkt er
nach mehr als 70 Arbeitsjahren nicht einmal im Traum daran, in Rente zu gehen.
Karl Schmid ist am 10. April 2021 gestorben!
Text: Auszug aus Bericht über Karl Schmid im Magazin Alblust 2/2016
© Copyright 2021 www.holzrechen.com
Seit über 70 Jahren arbeitet Karl Schmid - und denkt nicht im Traum ans Aufhören:
Der Rechenmacher feiert im Sommer 2016 seinen 87. Geburtstag, steht immer noch täglich in seiner Werkstatt in Schopfloch und ist
stolz drauf, dass seine Zähne bombenfest sitzen.
Die Freude an seiner Arbeit hat Karl Schmid nie verloren. So verlässt der Rechenmacher aus Schopfloch morgens gegen sieben Uhr
seine Wohnung, läuft quer über den angrenzenden Hof, wo sich auf Paletten Buchen- und Eschenholz türmen, lässt das Sägewerk
rechts liegen, und schließt die grün lackierte Metalltür zu seiner Werkstatt auf.
Die schwere Tür, die ein bisschen klemmt, bleibt nur an Sonntagen verschlossen. Dann gönnt sich der fast 87-jährige Karl Schmid eine
Ruhepause. An allen anderen Tagen aber werkelt er von morgens früh bis gegen 18 Uhr, getreu seinem Motto ,,I kann net ogschafft sei."

Geschichte
Rechen- und Stielfabrikation • Karl Schmid e. K. • Schopfloch/Schwäbische Alb
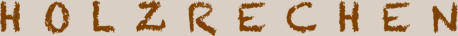

Seit über 70 Jahren arbeitet Karl Schmid - und denkt nicht im Traum ans Aufhören:
Der Rechenmacher feiert im Sommer 2016 seinen 87. Geburtstag, steht immer noch täglich in seiner Werkstatt in Schopfloch und ist
stolz drauf, dass seine Zähne bombenfest sitzen.
Die Freude an seiner Arbeit hat Karl Schmid nie verloren. So verlässt der Rechenmacher aus Schopfloch morgens gegen sieben Uhr
seine Wohnung, läuft quer über den angrenzenden Hof, wo sich auf Paletten Buchen- und Eschenholz türmen, lässt das Sägewerk
rechts liegen, und schließt die grün lackierte Metalltür zu seiner Werkstatt auf.
Die schwere Tür, die ein bisschen klemmt, bleibt nur an Sonntagen verschlossen. Dann gönnt sich der fast 87-jährige Karl Schmid eine
Ruhepause. An allen anderen Tagen aber werkelt er von morgens früh bis gegen 18 Uhr, getreu seinem Motto ,,I kann net ogschafft sei."
Unter dem lauten Getöse der gut 60 Jahre alten Maschinen fräst, sägt, schmirgelt und poliert er grobe Vierkanthölzer zu glatten Stielen, die angenehm in der
Hand liegen. Bohrt Löcher in das Rechenhaupt, sodass die Späne in alle Richtungen fliegen und es plötzlich angenehm nach warmen Holz riecht. Fixiert dann
die sorgsam gesägten Rechenzähne mit wenigen Hammerschlägen in den dafür vorgesehenen Löchern. Macht den Wackeltest und sagt schließlich zufrieden:
„Da fällt kein Zahn raus, auch nicht in zehn Jahren."
Alle Zähne sind rausgefallen
Dann verrät Karl Schmid, wieso die Zinken seiner Rechen ganz ohne Leim bombenfest sitzen. “Das Holz für die Zähne muss trocken sein, das für das
Rechenhaupt feuchter", sagt er. Wenn das Holz des Rechenhaupts trocknet, sich zusammenzieht und die Löcher enger werden, dann sitzen die Zähne noch
fester. Mit einem verschmitzten Lächeln erzählt er, was einem Händler widerfahren ist, der vorübergehend anstatt Rechen aus seiner Werkstatt Billigware aus
dem Ausland ins Sortiment genommen hat: „Alle Zähne sind rausgefallen und sie mussten sie einzeln reinleimen." Fortan standen wieder Rechen „Made in
Schopfloch" in dem Laden.
Im Jahr 1944 hat Karl Schmid eine Ausbildung als Wagnermeister in der Werkstatt seines Vaters begonnen. Geschafft wurde damals noch mitten im Flecken,
was wegen des Maschinenlärms nicht jedem Nachbarn gefiel. Kurz vor Kriegsende wurde der Lehrbub noch eingezogen, landete in französischer Kriegs-
gefangenschaft und musste nach seiner Entlassung kräftig ran im elterlichen Betrieb, weil der Vater krank aus dem Krieg heimgekehrt war. Gemeinsam mit
einem seiner vier Brüder hat Karl, der älteste Sohn der Familie, Anfang der 1950er-Jahre eine geräumige Halle am Ortsrand von Schopfloch als neuen Firmen-
sitz gebaut. Der Maschinenpark, der in der Werkstatt steht, stammt noch aus dieser Zeit. Er ist komplett mit einer dünnen Schicht aus gelbem Holzstaub über-
pudert und verrichtet Tag um Tag seinen Dienst, genauso wie die wenigen Modelle, die noch von Karl Schmids Großvater stammen. "Wir haben für jeden
Arbeitsschritt eine eigene Maschine", sagt Karl Schmid stolz - das erspart ihm mühsames Umstellen.
Mit dem Bauboom kamen die Schaufelstiele
Der Rechenmacher zeigt auf die betagte 5-PS-Bandsäge, an der ein verstaubter Kehrwisch baumelt, geht vorbei an der Kreissäge, und steuert auf die U9 zu,
eine Schaufelstielfräsmaschine Baujahr 1953. Das grün lackierte Gerät hat Karl Schmid angeschafft, als die Nachfrage nach Rechen und Holzgabeln zurück-
ging. Weil das Baugewerbe boomte, begann er, auch Stiele für Schaufeln herzustellen.
Karl Schmid geht durch die Halle, vorbei an der Wand mit seinem gerahmten goldenen Meisterbrief, den ihm die Handwerkskammer zum 50. Jubiläum seiner
Meisterprüfung überreicht hat. Er schaltet das Gebläse ein, ein jaulendes Geräusch ertönt. Dann setzt Schmid die Fräsmaschine in Gang, greift sich ein knapp
zwei Meter langes Vierkantholz und schiebt es in die Maschine.
Er baut württembergische und badische Rechen
Jeder Handgriff sitzt. Zwischendurch fördert Schmid aus einer der vielen Taschen seiner Arbeitshose einen Schraubenzieher zutage und zieht rasch eine Mutter
nach. Gleich darauf hat die Fräsmaschine mit lautem Getöse das Holzstück komplett geschluckt und spuckt in Nullkommanichts einen runden Stiel aus.
Mit wenigen Schritten ist Karl Schmid an der Rundstabschleifmaschine, jagt das gerundete Stück Holz an einem rotierenden Stück Schleifpapier vorbei. Danach
lässt er den Stab durch seine Hände gleiten und macht den Fühltest, nickt zufrieden. "Wir verwenden Schleifpapier mit Körnung 150 und machen die Stiele
extra fein", erklärt er.
Dass Stiel nicht gleich Stiel und Rechen nicht gleich Rechen ist, verstehen Besucher erst, wenn Karl Schmid die Tür zu seinem Lagerraum aufschiebt und die
unterschiedlichen Modelle vorführt. Da gibt es den klassischen Holzrechen, der im Württembergischen verbreitet ist. Dessen Stiel teilt Karl Schmid mit der Säge
an der einen Seite in zwei Hälften. Die Enden fixiert er in den beiden Löchern, die er zuvor im Abstand von etwa 20 Zentimetern ins Rechenhaupt gebohrt hat.
Fertig! Das badische Modell ist aufwendiger anzufertigen, aber stabiler. Hier spaltet Karl Schmid den unteren Bereich des insgesamt dickeren Stiels in drei Teile
auf und verankert jedes einzelne in einem der drei Löcher des Rechenhaupts. „Im Badischen haben sie die Rechen dazu benutzt, um die Erde zu Spargelreihen
aufzuhäufeln", erklärt Schmid den Grund, wieso dieses badische Modell stabiler sein musste.
Besonders stolz ist der Schopflocher auf den Rechen, den sein verstorbener Bruder und er in den 1960er-Jahren entwickelt haben. „V-Rechen" nennt Karl
Schmid die stabile Kreation mit hölzernem Stiel und Rechenhaupt, in dem aus Stahl gefertigte, v-förmig zurechtgebogene Zähne stecken. Sie sind, anders als
die hölzerne Variante, bruchfest.
Egal, ob V-Rechen, badisches oder württembergisches Modell: Karl Schmid liefert seine gesamte Produktpalette, zu der auch Schaufel-, Spaten- und
Hauenstiele gehören, noch selbst an seine Kundschaft. “Die Kunden erwarten das", sagt er. Er setzt sich ein bis zwei Mal pro Woche hinter das Steuer seines
grauen VW Pritschenwagens und fährt die Ware aus. Seine Touren führen ihn bis ins Badische, wo er zum Beispiel das Zentrallager der Raiffeisenmärkte in
Kehl am Rhein beliefert.
Früher ist Karl Schmid auf einem Motorrad mit Anhänger zu seinen Kunden geknattert. Und vor dem Krieg hatte man ein Handwägele zum Ausliefern, aber da
war die Kundschaft auch im Umkreis von zehn Kilometern ", erzählt der Schopflocher.
Schon der Uropa fertigte Rechen für die Bauern
In seiner Familie hat die Arbeit mit Holz eine lange Geschichte. Auf einem Lieferschein, den Karl Schmid aus einer Ecke seiner mit Sägemehl überpuderten
Werkstatt herauszieht, prangt der Schriftzug "Tradition seit 1870".
Schmids Urgroßvater, ein Wagner, hat damals Hand- und Leiterwagen als Transportmittel hergestellt. Da fahren heute noch welche rum", sagt Karl Schmid
stolz. Außerdem fertigte schon der Uropa Rechen für die Bauern in Schopfloch und der Umgebung. Sein Sohn und wiederum dessen Sohn folgten seinem
Beispiel. Da war es nur logisch, dass auch Karl Schmid bei seinem Vater in die Lehre ging.
Sein Holz kauft er bei Gemeinden, Städten und Forstämtern der Region. Bis vor zwei Jahren hat er es noch selbst im eigenen Sägewerk zurechtgeschnitten, auf
Paletten gesetzt und ein bis zwei Jahre trocknen lassen. Inzwischen aber wird es angeliefert - es gibt auch so genug zu tun für den betagten Rechenmacher
und die zwei 450-Euro-Kräfte, die er beschäftigt.
Gerade einmal ein Stündchen Mittagspause genehmigt sich der fast 87-Jährige während seiner Sechs-Tage-Woche.
Wer rastet, der rostet - davon ist Karl Schmid zutiefst überzeugt. Wenn die Leute nicht mehr gerne schaffen, dann fängt das Ende langsam an. Und wenn man
sich nicht bewegt, geht es gleich ganz schnell den Bach runter", sagt der Mann mit der Schildkappe, und fügt - wie als Beweis - hinzu: „Ich war noch nie krank".
Ein Grund dafür mag sein, dass er seine Arbeit mit Freude verrichtet Und während sich andere spätestens mit 65 in den Ruhestand verabschieden, denkt er
nach mehr als 70 Arbeitsjahren nicht einmal im Traum daran, in Rente zu gehen.
Karl Schmid ist am 10. April 2021 gestorben!
Text: Auszug aus Bericht über Karl Schmid im Magazin Alblust 2/2016
© Copyright 2021 www.holzrechen.com